
140 Jahre Russisches Licht
Dr. Natascha Drubek: "Von den Ikonen zum russischen Stummfilm"
"Russisches Licht" hieß eine mondäne städtische Beleuchtungsart, zuerst in Paris erprobt, die das Gaslicht ablöste. Natascha Drubek nimmt dieses "Licht der Moderne" als Metapher, um die tiefgreifende Beziehung des Lichts in den russischen Ikonen mit dem Licht in den einmaligen russischen Stummfilmen zu vergleichen, die ein Stück Klassik in der Filmgeschichte darstellen. Das gilt nicht nur für die legendären Filme von Eisenstein, Vertow, Pudowkin und anderen Meistern der 20iger Jahre, sondern vor allem auch für den Stummfilm der Zeit bis 1917: Filme wie DÄMMERUNG EINER FRAUENSEELE von Jewgeni Bauer.
Das "Russische Licht" von vor 140 Jahren leuchtete in den Großstädten nur kurz. Seine Faszination aber erstreckt sich etwa 20 Jahre länger als die Filmgeschichte: heute wäre "Russisches Licht" (in der Gestalt großer Glaskugeln, der Ikonen des Stummfilms) ein Anknüpfungspunkt für jede Erneuerung des Films (der durch Hollywood-Abbildrealismus und die Medien totgequatscht ist).
Natascha Drubek über 140 Jahre "Russisches Licht".



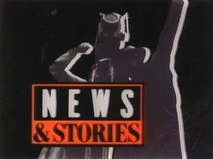





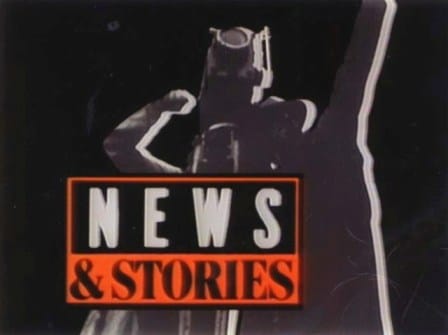
 RSS Feed
RSS Feed